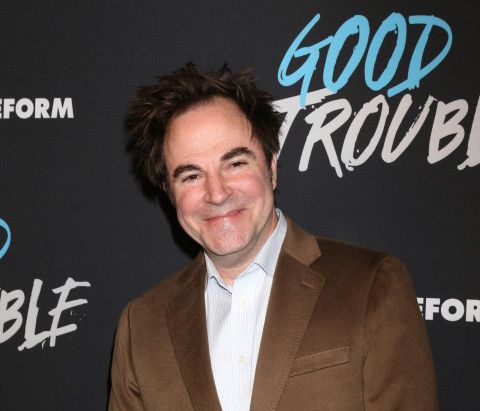So lebte es sich in "Spree-Chicago"
Die deutsche Hauptstadt in den 20er-Jahren erlebt seit "Babylon Berlin" ein Revival. So zeigt nun auch die beliebte "Terra X"-Geschichtsstunde, wie sich "Ein Tag in Berlin 1926" wohl zugetragen haben mag.
Spätestens seit dem Serienerfolg "Babylon Berlin" ist klar: Die deutsche Hauptstadt ist nicht nur heutzutage hipper Sehnsuchtsort für Sinnsucher, sondern war dies auch schon vor 90 Jahren. Das Berlin der 20er-Jahre war eine Weltmetropole voller Glanz und Abgründe. Zwischen ausschweifenden Partys und elender Armut, zwischen kultureller Blüte und politischen Kämpfen taten sich gigantische Widersprüche auf – die vor allem die kriminelle Unterwelt zu nutzen verstand. Das illustrierte schon "Babylon Berlin" eindrücklich, und nun zeigt auch die beliebte "Terra X"-Reihe auf, wie "Ein Tag in Berlin 1926" wohl ausgesehen haben könnte.
Nicht umsonst wurde Berlin damals "Spree-Chicago" getauft: Die Kriminalitätsrate schnellt empor, Verbrecherbanden kontrollieren die Stadt, durchschnittlich drei Menschen werden pro Woche ermordet. "Terra X" erzählt die Geschichte eines fiktiven Mannes, der dem Chaos Einhalt gebieten will. Fritz Kiehl arbeitet als Ermittler in der ersten Mordkommission der Welt, die mit modernsten Methoden auf Verbrecherjagd geht. Im Fokus der Doku-Fiktion steht ein Raubmörder, der nur mit neu entwickelten Verhören, Laborarbeit und öffentlicher Fahndung gefasst werden kann.
"Terra X: Ein Tag in Berlin 1926" zeigt die von so genannten Ringvereinen kontrollierte Unterwelt Berlins ebenso wie die tägliche Arbeit der Ermittler, von denen nicht wenige – so wie Fritz Kiehl – kriegsversehrt waren. Der dokumentarische Blick der Autoren Arne Peisker, Jens Afflerbach und Sigrun Laste richtet sich auch auf den oft mühsamen, bisweilen aber vergnüglichen Alltag der Berlinerinnen und Berliner der Weimarer Republik. Neben den fiktionalen Szenen zeigen dokumentarische Ausschnitte, wie sich Experten heute den 20er-Jahren in Berlin nähern.
Quelle: teleschau – der Mediendienst