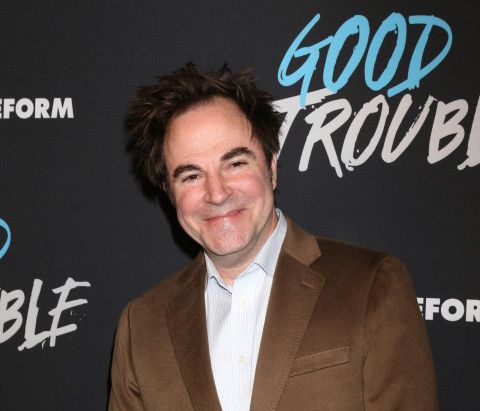Die "Drushba-Trasse": eine Pipeline für die Freundschaft
Es gab eine Trasse vor der Trasse. Schon in den 70er-Jahren lieferte Russland Erdgas und Erdöl an andere Ostblockstaaten und in den Westen. Es gab Gas und Erdöl gegen Bauleistungen an der "Drushba-Trasse" – insgesamt 2.750 Kilometer über Flüsse, Sümpfe und Stauseen.
Wie Angehörige anderer Ostblock-Staaten beteiligten sich etwa 25.000 DDR-Bürger am 1974 beschlossenen Bau der bis dahin größten Erdgasleitung der Welt zwischen Russland und der DDR. Auch der Westen partizipierte trotz vielfacher Einwände der USA. Im Film "Jahrhundertbauwerk Trasse – Wie das russische Erdgas in den Westen kam" von Matthias Schmidt erinnern sich ehemalige Mitarbeiter an der "Drushba-Trasse" ("Trasse der Freundschaft") an die damalige Zeit. Sie erinnern sich an Vorteile wie den Hauch von Freiheit, aber auch an die Entbehrungen, die ihnen die Arbeit in der Fremde brachte.
Da ist der Beitrag mit tollen geschichtsträchtigen Bildern ganz nah bei den Menschen. Aber der Film (MDR, 2020) ordnet den Pipeline-Bau auch weltpolitisch ein. Das vorausgegangene Erdgasröhren-Geschäft von 1970 war der wohl größte West-Ost-Handelsvertrag der Nachkriegsgeschichte. Westeuropa lieferte damals Rohre und gab Kredite. Der Bau selbst trotze dann allen Widrigkeiten des Kalten Krieges, unter anderem auch amerikanischen Embargos.
Die Überland-Trassen (parallel gezogene Röhren) blieben über Jahrzehnte ein fester Bestandteil der westeuropäischen Energieversorgung, bis es in den Nullerjahren zum Streit zwischen Russland und der Ukraine kam. Der Film stellt nicht zuletzt auch die Frage, welchen Einfluss die Trasse auf den Fall der Mauer nahm.
Jahrhundertbauwerk Trasse – Wie das russische Erdgas in den Westen kam – Do. 24.10. – ARTE: 20.15 Uhr
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH