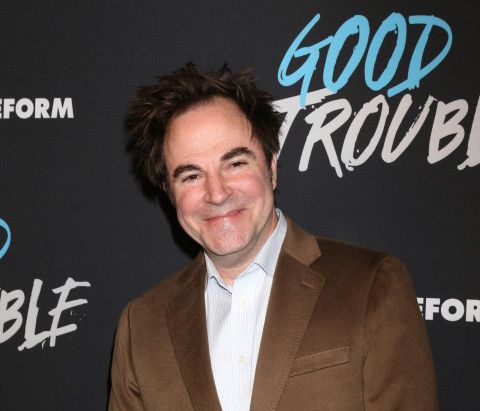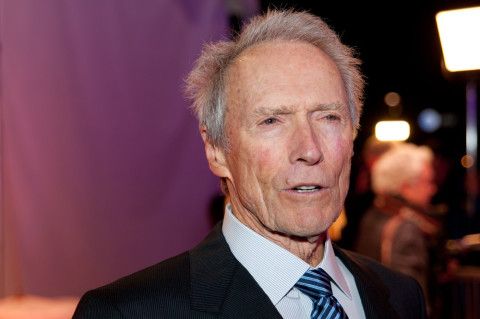Originaltitel
Wissenschaft extrem
Produktionsland
D
Produktionsdatum
2025
Info, Zeitgeschehen
Wissenschaft extrem
Sterben, damit Millionen Menschen leben: Die moderne Medizin ist eine Errungenschaft, die hart erkämpft wurde. Pioniere trieben rettende Ideen voran - und ließen dabei ihr eigenes Leben. Im 19. Jahrhundert entdeckt Ignaz Semmelweis die lebensrettende Wirkung der Desinfektion und stirbt unter ungeklärten Umständen. Der Medizinstudent Daniel Carrión jagt einer tödlichen Infektionskrankheit nach, Erfinder Sieur Fréminet geht auf tödlichen Tauchgang. Forscherinnen und Forscher griffen oft zu extremen Maßnahmen, um ihre Ideen und die Wissenschaft für das Wohl der Menschheit voranzubringen. Einer von ihnen war der Arzt und Geburtshelfer Ignaz Semmelweis - der im 19. Jahrhundert am Wiener Allgemeinen Krankenhaus eine seltsame Beobachtung macht. Er stellt fest, dass jede zehnte Frau nach der Geburt am Kindbettfieber stirbt. Auf einer zweiten Station, auf der vor allem Hebammen lernen und arbeiten, ist die Sterberate der Mütter deutlich niedriger. Semmelweis vermutet: Die Ärzte selbst schleppen tödliche Keime an. Damals forschen und üben sie an Leichen. Anschließend arbeiten sie auf der gynäkologischen Station. Sein Vorschlag: Seine Kollegen sollen sich die Hände desinfizieren, bevor sie die Patientinnen berühren. Die Ärzteschaft ist empört, doch Semmelweis' Vorschlag funktioniert: Die Sterblichkeitsrate der jungen Mütter sinkt dramatisch. Dennoch wollen seine Kollegen diesen Verdienst nicht anerkennen. Auch plagt Semmelweis sein schlechtes Gewissen, denn auch er könnte als Arzt todbringende Bakterien vom Seziertisch mitgebracht haben. Er versinkt in Depressionen, wird gegen seinen Willen in eine Nervenheilanstalt gebracht, in der der heute als "Retter der Mütter" geltende Mediziner unter nicht geklärten Umständen verstirbt. Im weit entfernten Peru greift eine mysteriöse Seuche um sich. Nach der Niederlage im sogenannten Salpeterkrieg 1884 ist das Land instabil - das damals unerforschte Oroya-Fieber, das Hunderte Menschen dahinrafft, sorgt für zusätzliche Verunsicherung in der Bevölkerung. Die Suche nach dem Ursprung der Infektionskrankheit wird zur nationalen Priorität. Ein ehrgeiziger Medizinstudent namens Daniel Alcides Carrión ist fest entschlossen, eine Erklärung zu finden, und wagt ein lebensgefährliches Experiment: Er will einen Patienten absichtlich infizieren und den Krankheitsverlauf beobachten. Das Versuchsobjekt ist Carrión selbst. Der französische Erfinder Sieur Fréminet begibt sich im Dienst der Forschung in ganz andere Gefahr. Er träumt davon, die Unterwasserwelt zu erkunden, und entwirft ein revolutionäres Tauchgerät. Möglicherweise ein Wegbereiter für die moderne Taucherausrüstung. Fréminet testet das Gerät selbst, ahnt aber nicht, dass eine unsichtbare Gefahr auf ihn lauert. Von der Entwicklung lebensrettender Gegengifte über waghalsige Expeditionen bis hin zu bahnbrechenden, technischen Innovationen und der Bändigung der Elemente: Für viele bedeutende Fortschritte der Menschheit haben Forscherinnen und Forscher mit ihrem Leben bezahlt. Die sechsteilige Doku-Reihe beleuchtet sowohl ihre Heldentaten als auch ihre tragischen Schicksale.