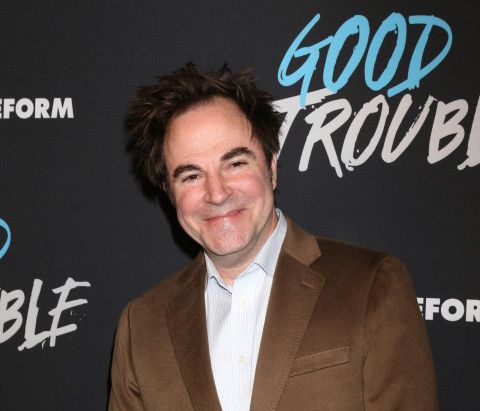Originaltitel
kulturMontag
Produktionsland
A
Produktionsdatum
2025
Kultur, Magazin
kulturMONTAG
Durch Musik geeint? – Das ESC-Israel-Dilemma: "United by Music" lautet das Motto des 70. Eurovision Song Contests (ESC), der im Mai 2026 in Wien ausgetragen wird. Während Kanada als neuer Teilnehmer dazustoßen könnte, erwägen oder fordern gar andere Länder einen Boykott, sollte Israel aufgrund des Nahost-Krieges nicht ausgeschlossen werden. Auch eine Gruppe von 55 Europaangeordneten aus 15 Ländern wandte sich an die Europäische Rundfunkunion(EBU), wurde doch der anhaltende Konflikt im Gazastreifen von einer unabhängigen UN-Kommission als möglicher Völkermord eingestuft. Schon im Vorfeld des diesjährigen ESC in Basel kam es zu Anti-Israel-Demos gegen den Auftritt der Sängerin und Überlebenden des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023, Yuval Raphael, die schließlich Top 3 des Bewerbs erreichte. Wochenlang tobte ein heftiger Streit, die EBU sah sich zu einer vorgezogenen Versammlung im November gezwungen und wollte die Mitglieder abstimmen lassen. Durch den Waffenstillstand seit Anfang Oktober verschoben die Verantwortlichen den Termin auf den regulären im Dezember. Welche Entscheidung wird die Generalversammlung fällen? Und kann die Resolution des UN-Sicherheitsrates, die den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump unterstützt, zur Beruhigung beitragen? Ist eine Cancel Culture bei dem Wettbewerb, der seit seiner Gründung für Völkerverständigung und Frieden durch Musik steht, eine legitime Maßnahme? Die österreichische wie die bundesdeutsche Regierung setzen sich für eine Teilnahme Israels ein. Die renommierte französisch-israelische Soziologin Eva Illouz, ausgewiesene Kritikerin der Netanyahu-Regierung, wurde selbst erst im November von der Erasmus-Universität in Rotterdam ausgeladen. Ihren geplanten Vortrag müsse man nach interner Debatte und demokratischer Abstimmung absagen, da man sich mit ihrem Besuch sehr unwohl fühle. Im "kulturMontag" spricht Illouz über das neue "Unwohlsein mit Juden", Kritik und Hass sowie Dialog statt Dämonisierung. Die Freiheit des Denkens – Porträt Hannah Arendt zum 50. Todestag: Wer von der "Banalität des Bösen" spricht, zitiert damit – oft, ohne es zu wissen – die große Denkerin Hannah Arendt. Die politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts waren ihr Lebensthema, ihre Aufgabe als politischer Geist sah die einflussreiche, scharfsinnige wie streitbare Zeitgenossin darin, die Welt und die Menschen zu verstehen. Auch 50 Jahre nach ihrem Tod, der sich im Dezember jährt, ist sie im öffentlichen Diskurs präsenter denn je, ihre Schriften werden nach wie vor gelesen und zitiert. Als junge Frau musste sie 1933 vor den Nationalsozialisten flüchten und ihre deutsche Heimat verlassen. Die Auseinandersetzung mit dem Wesen der totalitären Diktatur ließ sie nicht mehr los. Sie war überzeugt: "Der Totalitarismus vergiftet die Gesellschaft bis ins Mark." Im amerikanischen Exil wurde sie zu einer der wichtigsten politischen Theoretikerinnen des 20. Jahrhunderts, dessen politische Umwälzungen ihren Lebensweg prägten. Bis zur Einbürgerung in den USA 1951 war sie staatenlos. Von der systematischen Ermordung der Juden erfuhr Arendt 1943 in ihrem New Yorker Exil. Die "konsequenteste Institution totaler Herrschaft" sah sie in den NS-Konzentrationslagern – den "Vernichtungsfabriken", in denen Millionen Menschen ermordet wurden. Im Jahr 1961 erhielt Arendt Gelegenheit, Adolf Eichmann, einen der Hauptverantwortlichen für die Organisation des Holocaust, aus der Nähe zu erleben. Mit ihrem Buch "Eichmann in Jerusalem" löste sie eine Kontroverse aus. Denn Kritiker sahen darin eine Verharmlosung des NS-Täters, was aber nicht der Intention der Autorin entsprach. Ihre Analysen wirken erstaunlich aktuell, als seien ihre Überlegungen für unsere Gegenwart geschrieben. Bis heute ist Hannah Arendt die einzige Frau, die neben unzähligen Männern weltweit als Referenz in der Politikwissenschaft und politischen Philosophie anerkannt wird.