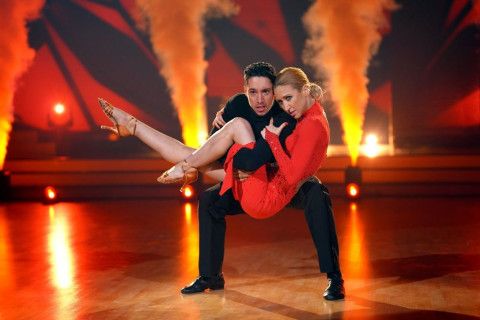Kriegsberichterstattung im TV: Was macht das mit uns – und was hilft?
Der Krieg in der Ukraine bestimmt die Nachrichten, täglich erreichen uns teils grausame Bilder im Fernsehen und im Netz. Was macht das mit uns? Psychologen geben Antworten – und Tipps, damit umzugehen.
Zerbombte Städte, zerstörte Existenzen, verzweifelte Menschen auf der Flucht: Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ähneln sich die täglichen Bilder in den Medien. Im Fernsehen erreicht uns zwischen Morgenmagazinen und Nachtnachrichten Kriegsberichterstattung in Dauerschleife, Sender wie n-tv kennen seit Wochen kaum ein anderes Thema. Ganz zu schweigen von den Sozialen Medien, in denen sich Fotos, Videos – und damit auch Propaganda – meist ungeprüft rasant verbreiten. "Doomscrolling" wird ein schon aus der Coronapandemie bekanntes Phänomen genannt: Wir starren auf die schlechten Nachrichten in den Facebook- und Instagram-Timelines unserer Smartphones und können damit nicht mehr aufhören. Was macht diese unaufhörliche Kriegsbeschallung mit uns auf Dauer? Psychologinnen und Psychologen klären – paradoxerweise zwischen Bunkerbildern und Atomkriegspanik – in TV und Netz über die Folgen des Medienkonsums in Kriegszeiten auf.
Die Bilder und Berichte in den Medien erzeugten ein Gefühl von Unsicherheit, das unserem existenziellen Bedürfnis nach Sicherheit entgegenstehe, erklärt etwa die Psychologin Nesibe Özdemir im Format "psychologeek" des Jugend-Netzwerks Funk von ARD und ZDF. Um dagegen anzukämpfen, entwickelten wir Kontrollstrategien – etwa besagtes "Doomscrolling". Dabei würden zwar die gesamte Zeit Informationen aufgesaugt, der Konsum der Nachrichten geschehe aber oft sehr passiv, so die Expertin. Dies könne Hilflosigkeits- und Ohnmachtsgefühle verstärken. Beim "Doomscrolling" wechsle man "ständig zwischen Anspannung, weil man Schlimmes liest, und Entspannung, wenn man nichts Schlimmes findet", ordnet auch WDR-Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori in einem Beitrag des Senders ein.
Ohnmacht kann eine "Abwärtsspirale" erzeugen
Man kann es an sich und den Menschen im Umfeld beobachten: Nicht jeder ist gleich anfällig für die medial ausgelöste Kriegsangst. Es komme auf die Bewertungen an, bestätigt Psychologin Özdemir im Funk-Video: Nimmt man die Nachrichten nüchtern auf oder fühlt man sich beispielsweise auch hier in Deutschland unmittelbar bedroht? Letzteres kann durchaus problematisch sein, wie die Psychologinnen und Psychologen übereinstimmend sagen: Ohnmacht könne eine "Abwärtsspirale" erzeugen, aus der man nicht so einfach wieder herauskomme, so Özdemir. Man empfinde Kontrollverlust, sagt auch Psychotherapeutin Heide Glaesmer vom Universitätsklinikum Leipzig im Interview mit "MDR um 4" – und das, "ohne wirklich handeln zu können".
Aber was tun, sobald man nach ausführlichem Medienkonsum einmal davon erfasst ist? Auch hier wissen die Experten Rat – die Tipps gegen Kriegsangst scheinen online und im TV mittlerweile ein kleines Subgenre zu bilden. Es sei wichtig, "die Gedanken dahinter zu befragen", rät Psychologin Özdemir: "Stimmt das wirklich, bin wirklich ohnmächtig?" Ganz ähnlich argumentiert ihre Kollegin Ruth Marquardt im Interview bei n-tv: "Ist das, was ich in meinem Kopf denke, wirklich real?" – mit dieser Frage könne man sich der Psychologin zufolge einfach immer wieder neu orientieren. Auch ganz konkret hat die Expertin Ratschläge für den Umgang mit Angst und Panik in derlei Situationen: Mit Atem- und anderen Übungen könne man vom "inneren Kampf- oder Fluchtmodus" wieder herunterkommen.
Nachrichtenkonsum einschränken, wenn es zur Belastung wird
Wäre es also, um dieser "Abwärtsspirale" zu entgehen, nicht das Einfachste, auf Bilder von Soldaten und Panzern, auf den Konsum martialischer Reden und trauriger Berichte hilfloser Opfer gänzlich zu verzichten? "Das Wichtigste ist eine gewisse Nachrichtenabstinenz", sagt die Expertin Glaesmer im MDR. Leuten, die dies sehr belaste, empfehle sie, einmal am Tag Nachrichten zu schauen – uns ansonsten: "Fernseher aus". Dafür könne man seinen Tag auch anders strukturieren und etwa positive Dinge tun, so die Leipziger Psychologin. Für den Smartphone-Konsum gelten ähnliche Ratschläge: "Psychologen sagen: Kein Doomscrolling", zitiert der WDR seine Wissenschaftsjournalistin. Natürlich sei es "auch völlig okay, mal zu sagen: Ich klinke mich aus, ziehe mich zurück, mache was anderes – sonst wird mir das zu viel", so Christina Sartori.
Den Konsum der Medien eingrenzen, sobald man Überforderung und Überlastung fühle – dazu rät bei Funk auch Psychologin Nesibe Özdemir. Die dauernde Verfügbarkeit von Informationen gebe jedem Individuum eine gewisse Verantwortung, mit diesen umzugehen – das betreffe auch die eigene Belastung. "Wir müssen nicht die ganze Zeit alle Informationen, die wir haben, aufsaugen", so die Psychotherapeutin. Das Problem laute: "Wir kriegen die Informationen, aber haben den Bezugsrahmen nicht." Schließlich sei nicht jeder Ukraine- oder Politikexperte. Man sollte daher zwischen der Qualität der einzelnen Informationen unterscheiden. Ratsam sei es etwa, online Journalistinnen und Journalisten zu folgen, die die Nachrichten schon vorgefiltert und in einen Bezugsrahmen gesetzt hätten.
Wie schon bei der Corona- und Flüchtlingskrise scheint es also auch bei der medialen Verarbeitung des Ukraine-Krieges um Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit zu gehen – inklusive der begleitenden Verunsicherung durch "Fake News", "Filterblasen" und Propagandamaterial. Auf Bilder und Videos von kaputten Städten und ausgebombten Zivilisten trifft dies umso mehr zu, wie etwa Susan Sonntag bereits 2003 in ihrem Buch "Das Leiden anderer betrachten" feststellte: Das Abbilden der Opfer führe zu Vereinfachung und der "Illusion eines Konsensus", so die Philosophin in ihrem viel zitierten Essay zur Kriegsfotografie.
Doch hob Sonntag in ihrem Werk zugleich auch einen anderen Effekt der medialen Kriegsdarstellung hervor: "Das Bild sagt: Setz dem ein Ende, interveniere, handle. Und dies ist die entscheidende, die korrekte Reaktion." Vielleicht, so darf man angesichts der enormen Solidaritätswelle mit den Geflüchteten hoffen, bewirken die in TV und Internet verbreiteten Kriegsbilder aus der Ukraine neben Verunsicherung und Ohnmachtsgefühlen auch eine Art Aufklärung – mit positiven, durchweg humanistischen Folgen.
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH