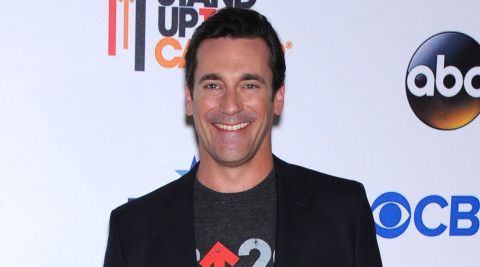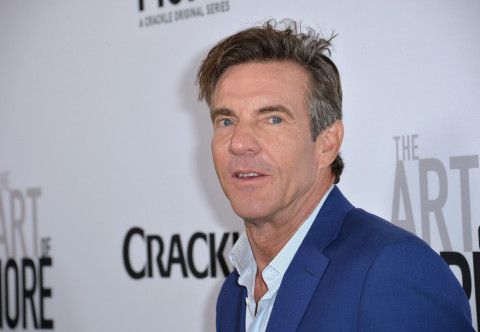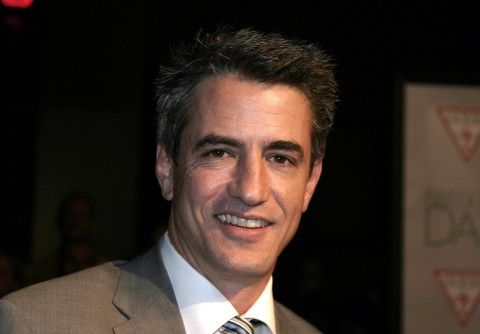Black Panther: Wakanda Forever
Filmkritik
Nach dem Krebstod von Black-Panther-Darsteller Chadwick Boseman mussten die Marvel-Macher umplanen, nun legen sie ein solides zweites Abenteuer rund um das mächtige afrikanische Königreich Wakanda vor. Auch wenn "Black Panther: Wakanda Forever" hinter dem Vorgänger zurückbleibt, gibt es einiges zu bewundern.
Überragend war der Erfolg, den der Marvel-Blockbuster "Black Panther" 2018 an den Kinokassen feiern konnte, das Einspielergebnis lag am Ende bei über 1,3 Milliarden US-Dollar. Daher musste es nicht verwundern, dass eine Fortsetzung mit den Beteiligten des Ursprungsfilms recht schnell offiziell bestätigt wurde. Noch während der Drehbuchentwicklung erlag Hauptdarsteller Chadwick Boseman allerdings einem Krebsleiden, von dem Regisseur Ryan Coogler und Kevin Feige, der kreative Kopf der fortlaufenden Marvel-Reihe, nichts gewusst hatten. Die traurige Nachricht machte 2020 eine umfangreiche Neuausrichtung notwendig, wobei sehr schnell klar war, dass man Bosemans Rolle als König T'Challa nicht mit einem anderen Schauspieler besetzen würde.
"Black Panther: Wakanda Forever" beginnt nun mit dem krankheitsbedingten Tod des mutig-aufrechten Herrschers über das lange Zeit strikt von der Außenwelt abgeschottete afrikanische Reich Wakanda. Während sich T'Challas technikbegeisterte Schwester Shuri (Letitia Wright), eine gewiefte Rüstungs- und Waffenerfinderin, wie wild in ihre Forschungsarbeit stürzt, um den Schmerz zu vergessen, ist ihre Mutter Ramonda (Angela Bassett) an mehreren Fronten gefordert. Der Tod ihres Sohnes, der den Wakandanern als mit Superkräften ausgestatteter Black Panther das Gefühl von Sicherheit gab, hat eine große Lücke hinterlassen. Als Königin muss sie nach innen Stärke zeigen, Zuversicht ausstrahlen und nach außen die Souveränität ihrer Nation verteidigen. T'Challas Ableben ruft nämlich diverse Länder auf den Plan, die nur zu gerne endlich in Besitz des nur in Wakanda vorkommenden Supermetalls Vibranium gelangen würden.
Als der besondere Stoff überraschend irgendwo auf dem Meeresboden entdeckt und die komplette Bergungscrew getötet wird, hat die CIA umgehend das afrikanische Königreich in Verdacht. Verantwortlich für den Angriff ist in Wahrheit aber Namor (Tenoch Huerta), der Anführer eines bislang verborgenen mittelamerikanischen Unterwasservolkes, das im Geheimen zu einem großen Schlag ausholt. Um neue Bohrungen zu verhindern, will Namor die Wissenschaftlerin Riri Williams (Dominique Thorne) töten, die das hochkomplexe Bergungswerkzeug entwickelt hat. Ins Spiel kommen an diesem Punkt die Wakandaner, die die junge Frau für ihn aufspüren und fassen sollen. Begleitet von Okoye (Danai Gurira), dem Oberhaupt der königlichen Leibgarde der Dora Milaje, macht sich Shuri nach anfänglichem Zögern auf den Weg in die USA.
"Black Panther: Wakanda Forever" erinnert in mehrfacher Hinsicht an die Ende Oktober 2022 gestartete DC-Comicadaption "Black Adam". Hier wie dort reißt die Handlung imperialistische Tendenzen und das Grauen des Kolonialismus an. Und in beiden Fällen spielt der Durst nach Rache für erlittenes Leid eine zentrale Rolle. Obwohl auch der mittlerweile 30. Beitrag der Marvel-Leinwandreihe nicht besonders tief gräbt, wirkt Cooglers Film stimmiger, durchdachter, weniger zusammengeschustert als der hanebüchen gebaute Blockbuster der Konkurrenz.
Im Gegensatz zu seinem Kollegen Jaume Collet-Serra, der einen nicht mal besonders wertig aussehenden digitalen Overkill kreierte, findet Ryan Coogler einen guten Mittelweg zwischen Computereffekten und handgemachten Actionelementen. Bahnbrechend originelle Bilder und Kampfszenen sollte man in "Black Panter: Wakanda Forever" zwar nicht erwarten. Allein der Blick in die Welt der Talocan genannten Unterwasserzivilisation hat jedoch etwas Erfrischendes an sich – selbst wenn das Ganze manchmal an den DC-Streifen "Aquaman" denken lässt.
Würdevolle Trauer um Chad Boseman
Zu den stärksten Szenen der "Black Panther"-Fortsetzung zählen zweifellos die Momente, in denen die Macher dem verstorbenen T'Challa – und damit auch seinem Darsteller Chadwick Boseman – huldigen. Kraftvoll-bewegend ist etwa die Panoramaeinstellung zu Beginn, die nach dem Trauerzug die in Weiß gehüllten Bewohner Wakandas auf den Straßen und den Gebäuden der Hauptstadt zeigt. Ähnlich stark fallen die letzten Minuten des Films aus, wenn das Säuseln des Windes der Trauer um den Verlust ausreichend Raum gibt. Wo sonst gerne laute, penetrante Musik angestimmt wird, präsentiert sich der Blockbuster erfreulich ruhig und feinfühlig.
Ein paar Blößen geben sich Ryan Coogler und Ko-Drehbuchautor Joe Robert Cole bei der Figurenführung und beim Aufbau ihrer Geschichte, die natürlich darauf hinausläuft, dass eine andere Person das Black-Panther-Kostüm überstreift. Einige Schlenker des Plots wirken arg forciert. Jungwissenschaftlerin Riri Williams, die als Ironheart bald ihren eigenen Serienableger bekommt, erhält noch zu wenig Profil. Und Shuris eigentlich spannende emotionale Reise wird auf eher plumpe Weise zu einem vorläufigen Ende gebracht. Was ebenfalls auffällt: Mit 161 Minuten Laufzeit ist das Sequel definitiv zu lang. Der insgesamt hohe Unterhaltungswert lässt am Ende aber auch darüber hinwegsehen.
Black Panther: Wakanda Forever, im Kino ab: 09.11.2022
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
















Darsteller






Neu im kino






























Gerne gesehen