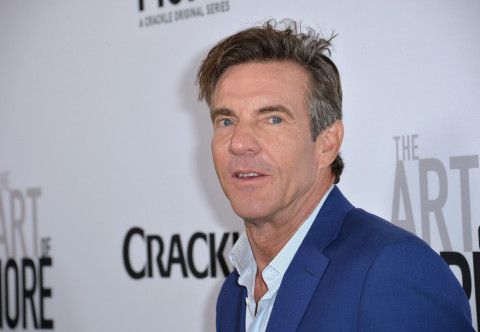Harriet - Der Weg in die Freiheit
Filmkritik
Harriet Tubman war eine Sklavin, die erst sich selbst befreite und dann andere. Das Biopic "Harriet – Der Weg in die Freiheit" setzt dieser mutigen Freiheitskämpferin ein Denkmal.
Nach zwei Stunden Film, nach Szenen voller Gewalt gegen Sklaven und himmelschreiender Ungerechtigkeit, steht Harriet Tubman in einer Wiese und blickt in den Sonnenaufgang. Gott, sagt sie, habe ihr die Zukunft gezeigt, und diese Zukunft sei gut. Es ist einer der traurigsten Momente dieses Films, der von einer mutigen schwarzen Frau erzählt, die im 19. Jahrhundert erst sich selbst und dann Dutzende andere in den Vereinigten Staaten aus der Sklaverei befreite. Denn auch wenn die Zukunft, die Harriet da in der Wiese sah, besser ist als das, was sie selbst erleben musste: Gut ist sie noch lange nicht.
Harriet Tubman wurde um das Jahr 1820 herum als Araminta "Minty" Ross in die Sklaverei geboren. Im Biopic "Harriet – Der Weg in die Freiheit" wird sie nun von der Britin Cynthia Erivo gespielt, die für ihre beeindruckende Darstellung für einen Oscar nominiert wurde (gewonnen hat dann doch, wie fast immer, eine Weiße). Der Film erzählt Tubmans Leben recht schnörkellos nach. Man sieht, wie "Minty" auf einer Farm im Maryland der 1840er-Jahre schuftet, wie sie von ihrem Herren die Erlaubnis erhält, ihren Partner (Zackary Momoh) zu heiraten, und wie sie schließlich alles zurücklässt, um in den Norden der USA zu fliehen, weil sie verkauft werden soll wie ein Stück Vieh. In Philadelphia, wo die Sklaverei verboten ist, schließt sie sich einer Untergrundorganisation an, die Sklaven aus dem Süden befreit und in den Norden bringt. Schließlich kämpft sie sogar im amerikanischen Bürgerkrieg mit der Waffen in der Hand gegen die Sklavenhalter aus den Konföderiertenstaaten.
Regisseurin Kasi Lemmons inszeniert all das über weite Strecken wie einen Abenteuerfilm. Im Zentrum der Handlung steht zunächst die Flucht von "Minty", später dann (sie hat sich mittlerweile selbst den Namen Harriet Tubman gegeben) ihre spektakulären Rettungsaktionen in den Südstaaten. "Harriet" ist über weite Strecken klassisches Spannungskino, das auch nicht vor Klischees, wie man sie aus dem Genre zur Genüge kennt, zurückschreckt. Man merkt die Intention der Macher, mehr als nur eine dröge Geschichtsstunde abliefern zu wollen, in fast jeder Szene. Bisweilen ist das zu viel des Guten. Die Figur der Harriet Tubman verschwindet in der mit überdramatischer Musik unterlegten Actionsause manchmal, geht inmitten von Sonnenuntergängen und sonstigem Kitsch unter.
Den vielleicht seltsamsten Aspekt des an sich schon ungewöhnlichen Lebens von Harriet Tubman bringt Regisseurin Lemmons in ihrem Film dennoch unter. Als junges Mädchen wurde Tubman von einem Sklavenbesitzer so schwer am Kopf verletzt, dass sie fortan nicht nur immer wieder am helllichten Tage unvermittelt einschlief; auch glaubte Tubman, Gott würde zu ihr persönlich sprechen, und sie hatte Visionen von ihrer eigenen Zukunft und der ihrer schwarzen Mitmenschen.
"Harriet – Der Weg in die Freiheit" sollte schon im April in die deutschen Kinos kommen, wegen der Corona-Krise wurde der Start verschoben. Jetzt, da nicht nur die USA wieder über Gewalt gegenüber Schwarzen sprechen, ist "Harriet" der Film der Stunde. Das Biopic basiert auf historischen Tatsachen, ist aber vor allem eine Anklage, bei der zwar die Vergangenheit vor Gericht steht, unterschwellig immer aber auch das Hier und Jetzt. Das macht den Film trotz allem sehenswert.
Vor wenigen Jahren wäre Harriet Tubmans Konterfei übrigens beinahe auf dem amerikanischen 20-Dollar-Schein gelandet. Nach einer Intervention von Donalds Trumps Finanzminister Steven Mnuchin aber blieb das Gesicht von Andrew Jackson auf dem Stück Papier. Jackson war der siebte Präsident der USA – und Sklavenbesitzer.
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH















Darsteller
News zu Harriet
Neu im kino






























Gerne gesehen