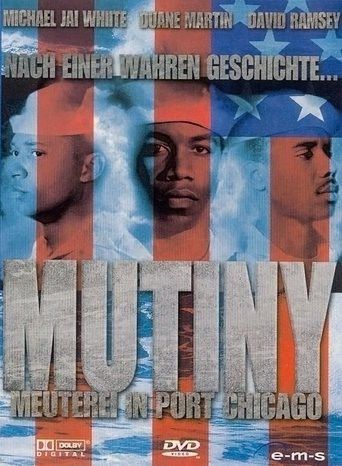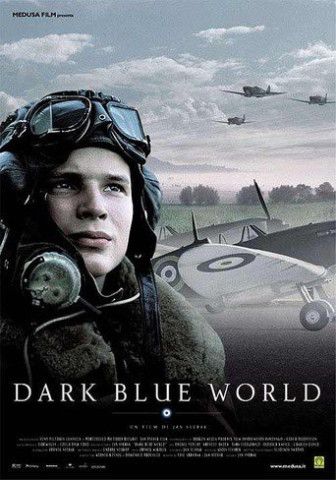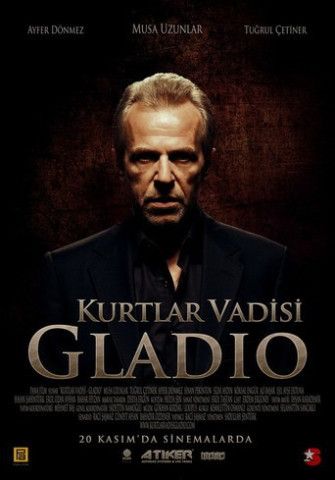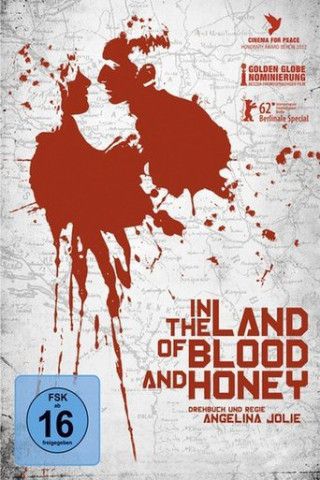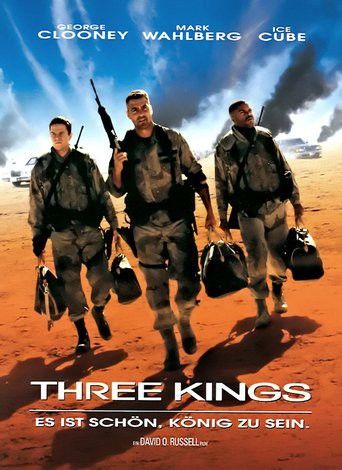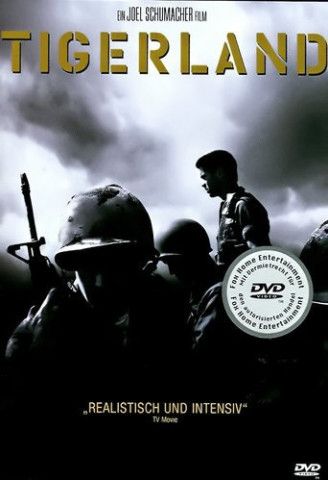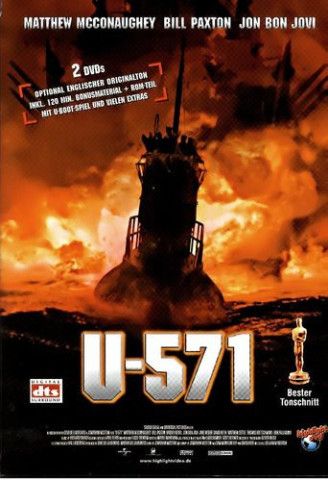Dunkirk
Filmkritik
Christopher Nolans hervorragender Kriegsfilm "Dunkirk" zeigt die Schrecken des Kriegs und verzichtet dabei auf explizite Gewalt. Eindringlich ist der Film dennoch.
Wie brutal muss ein Kriegsfilm sein, damit er abschreckend wirkt? Christopher Nolans Weltkriegsepos "Dunkirk" erzählt von dem Drama, das sich im Mai und Juni 1940 am Strand der nordfranzösischen Stadt Dünkirchen abgespielt hat. Zehntausende alliierte Soldaten starben damals in der von Deutschen umzingelten Stadt, aber Hunderttausende überlebten, weil sie gerade noch rechtzeitig in einer spektakulären Rettungsaktion über den Kanal zurück nach England gebracht wurden. All das erzählt Nolan, ohne einen einzigen Tropfen Blut zu zeigen. Folglich wurde, was im Vorfeld für Diskussionen sorgte, "Dunkirk" auch für Jugendliche freigegeben. Scheute Nolan explizite Bilder, um auch die jungen Zuschauer ins Kino zu locken?
Ist "Dunkirk" ein Kriegsfilm?
Mitnichten, sagt der Gescholtene. Er habe sich nicht auf die "blutigen Aspekte der Schlacht" konzentrieren wollen, das hätten schon so viele vor ihm gemacht. Und überhaupt: "Dunkirk" sei gar kein Kriegsfilm, sondern wolle vor allem eine spannende Geschichte erzählen. Das ist so natürlich nicht richtig.
"Dunkirk" ist ein Kriegsfilm, und was für einer. Aber mit einem hat Nolan dann doch Recht: Wenn sich tausende Soldaten am Strand niederducken, als deutsche Flugzeuge über ihnen ihre Bomben abwerfen, und dann viele aufstehen und manche liegenbleiben, dann ist das eindringlicher, als zerfetzte Leiber zu zeigen.
"Dunkirk" ist eine ungewöhnliche Geschichte für einen Kriegsfilm, in der einmal nicht die amerikanischen, sondern die britischen Truppen im Mittelpunkt stehen. Und das, obwohl sie die Schlacht von Dünkirchen eigentlich verloren und der Rückzug nur durch die britische Propaganda in einen Triumph umgemünzt wurde. Wenige Tage später nahmen deutsche Truppen Paris ein. Was in Frankreich passiert ist, sagte Winston Churchill wenige Tage nach der Rettungsaktion, sei nur ein kleiner Lichtblick inmitten eines militärischen Desasters. Entsprechend sieht Nolan auch davon ab, eine Heldengeschichte auf die Leinwand zu werfen. Hier gibt es keine trauernden Witwen und keine wehenden Fahnen.
Nolan konzentriert sich auf drei kleine Geschichten im Chaos des Dramas von Dünkirchen. Aus der Luft nähert sich ein Pilot (Tom Hardy) dem Strand, um feindliche Kampfflugzeuge abzudrängen, auf dem Wasser ein kleines Boot. Zusammen mit seinem Sohn (Tom Glynn-Carney) und dessen bestem Freund (Barry Keoghan) sowie Dutzenden anderen Schiffen macht sich Dawson (Mark Rylance) auf den Weg über den Kanal, um am Strand von Dünkirchen seine Landsleute zu evakuieren. Als "Dunkirk Spirit" sollte diese ungewöhnliche Rettungsaktion in die Geschichte eingehen. Nolans Hauptaugenmerk liegt allerdings bei den Geschehnissen am Strand selbst.
Aus dem Schlachtengemälde greift er einige Details heraus, vergrößert sie und illustriert so die Schrecken des Krieges. Kameramann Hoyte van Hoytema, mit dem Nolan schon bei "Interstellar" zusammengearbeitet hat, fängt das in großen IMAX-Bildern ein, bei deren Anblick man versteht, dass Nolan Streamingdiensten wie Netflix gegenüber ein gewisses Misstrauen hegt.
Der junge britische Soldat Tommy (großartig: Fionn Whitehead) rennt in der beklemmenden Anfangssequenz durch das menschenleere Dünkirchen, gerät unter Beschuss und steht plötzlich am unendlichen Sandstrand, und was sich da vor ihm auftut, ist der ganze Wahnsinn des Krieges. 400.000 britische Soldaten harren hier aus, von allen Seiten eingekesselt von den Deutschen, nur der Weg über das Meer ist offen, und man kann sie fast sehen, die britische Heimat und damit die Freiheit. In dem Durcheinander trifft Tommy den gleichaltrigen Alex und versucht mit ihm, dieser Hölle zu entfliehen.
Verpflichtet hat Nolan für die Rolle des Alex den ehemaligen One-Direction-Sänger Harry Styles. Er habe gar nicht geahnt, wie bekannt Styles sei, erzählte Nolan. Er habe den Teenie-Star vielmehr besetzt, "weil er wunderbar auf die Rolle gepasst hat und er es verdient hat, dabei zu sein." Tatsächlich macht Styles, der sich derzeit mit seinem neuen Album auch als ernstzunehmender Musiker profilieren will, seine Sache ziemlich gut. Er ist in dem Dreck der Schlacht kaum als der Popstar zu erkennen, der er ist.
Der Krieg ist in "Dunkirk" ein Überlebenskampf des Einzelnen, er ist das verzweifelte Ducken, wenn Bomben vom Himmel fallen, das Klammern an das letzte Schiff in Richtung Heimat oder der Kampf gegen die Wassermassen, die in das Cockpit dringen, nachdem Pilot Collins (Jack Lowden) im Ärmelkanals abgeschossen wurde. Gesprochen wird bei all dem kaum. Würde man alles aufschreiben, was in "Dunkirk" gesagt wird, es würde wohl kaum mehr Platz benötigen als dieser Text. Aber was gäbe es auch zu sagen?
Das Eindringlichste an "Dunkirk" sind dann auch nicht die Dialoge, es ist der Klang des Krieges, das markerschütternde Kreischen der deutschen Kampfflugzeuge, das Aufschlagen der Bomben auf dem hölzernen Pier und der Klang, den Kriegsschiffe machen, wenn sie ächzend auf Grund laufen. Dass der Krieg brutal ist und blutig, wusste man schon vor "Dunkirk". Jetzt weiß man auch, wie er sich anhört. Er klingt grauenvoll.
Quelle: teleschau – der Mediendienst
















Darsteller





News zu Dunkirk
Neu im kino






























Gerne gesehen










Das könnte dich auch interessieren